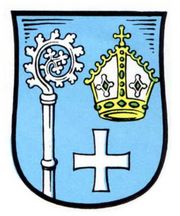Marienwerder/Kwidzyn
1. Toponymie
Deutsche Bezeichnung
Marienwerder
Amtliche Bezeichnung
poln. Kwidzyn
Etymologie
Bereits im 11. Jahrhundert wird an dieser Stelle eine prußische Siedlung namens Kwedis erwähnt (in den Quellen ab dem 13. Jahrhundert als Quedin, Quidino, Quedzyn bezeichnet). Ihr Name soll sich von dem prußischen Männernamen „Quede“ ableiten; später wurde das Areal als Werder Queden bezeichnet. Die Gründung des Deutschen Ordens wurde zu Ehren der Ordenspatronin Marienwerder, lat. Insula Sanctae Mariae, genannt.
2. Geographie
Lage
53°44′09″ nördlicher Breite, 18°55′51″ östlicher Länge 19,2–82 m über NHN, fünf km östlich der Weichsel am Fluss Liebe (poln. Liwa, rechter Nebenfluss der Nogat) gelegen. Die erste Siedlung befand sich fünf km nördlich der heutigen Stadt, auf einem Hügel an dem zwischen der Weichsel und dem Nogat-Liebe-Flusssystem gebildeten Werder.
Region
Historisch: Pomesanien in den Grenzen des Ordenslandes Preußen, Teil des Herzogtums Preußen, ab Ende des 18. Jahrhunderts Provinz Westpreußen im Königreich Preußen; heute: Pomorze Gdańskie (Danziger Pommern oder Ostpommern)
Staatliche und administrative Zugehörigkeit
3. Geschichte und Kultur
Gebräuchliche Symbolik
Das Stadtwappen zeigt auf blauem Schild heraldisch rechts einen silbernen Bischofsstab, links ebenfalls in Silber oben eine bischöfliche Mitra, unten ein griechisches Kreuz. In der ersten bekannten Darstellung aus dem 14. Jahrhundert gab es noch kein Kreuz, es wurde erst im 15. Jahrhundert in das Wappen aufgenommen. Im 19. Jahrhundert existierte auch eine Variante mit der Darstellung der Gottesmutter mit Kind in der Krümmung des Bischofsstabs sowie eine Version auf rotem Schild.
Archäologische Bedeutung
Die frühesten menschlichen Spuren werden auf 12.000 v. Chr. datiert (Nomaden, die der sogenannten Swiderien-Kultur angehörten). Erste Siedlungen in der Nähe der heutigen Stadt gab es in der Jungsteinzeit (3300–1700 v. Chr.), zahlreiche Spuren, v. a. in Form von steinernen Urnengräbern, sind nachweisbar.
Mittelalter
Während der Völkerwanderung zogen um 500 n. Chr. prußische Stämme in die Gegend, am rechten Weichselufer entstanden Siedlungen in Baldram, Podzamcze und Kwidzyn, die ihre Blüte im Zeitraum vom 10. bis zum 12. Jahrhundert erlebten.
1233 kamen Deutschordensritter in das Gebiet des Werders und gründeten auf dem Hügel fünf km nördlich der heutigen Stadt die erste Siedlung (später Klein Queden bzw. nach dem späteren Besitzer Tiefenau genannt). Schon bald wurde diese an einen strategisch günstigeren Ort am Südrand der späteren Stadt verlegt, die 1235 mit der Kulmer Handfeste ausgestattet wurde. Während der prußischen Aufstände 1242/43 und 1260–1273 wurde sie mehrfach überfallen und zerstört. Nach der Gründung des Bistums Pomesanien (1243) kam Marienwerder in bischöflichen Besitz, 1254 wurde es zum Sitz der Diözese, mit Domkirche (1254 begonnen) und Bischofsburg in der ehemaligen Ordensburg. Im ausgehenden 13. Jahrhundert zog der Bischof in die neuerbaute Residenz in Riesenburg/Prabuty um, in der Stadt residierte weiterhin das Domkapitel, für das 1322–1360 ein neuer Sitz errichtet wurde. 1336 wurde das Stadtrecht für Marienwerder erneuert, laut Quellen zählte die Stadt damals 51 Bürgerhäuser.[1]
Neuzeit
Nach dem Ständekrieg (1453–1466) verblieb die Stadt im Ordensland, sie wurde während der Kriege 1478 und 1520 stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach 1527 fand sie sich im Bereich des nunmehr säkularen Herzogtums Preußen, ab 1551 war sie Sitz der herzoglichen Hauptleute. In den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts blieb die Stadtbebauung weitgehend verschont, die Stadt wurde mehrmals von feindlichen Truppen besetzt und zur Zahlung von Kontributionen verpflichtet (1655 und 1658 von den Schweden, 1758 von den Russen). 1709 fand im Schloss ein Treffen von König Friedrich I. von Preußen (1657–1713) mit dem russischen Zaren Peter I. (1672–1725) statt. 1719 brach ein Feuer aus, bei dem ca. ein Drittel der Stadtbebauung zerstört wurde. 1765 wurde eine Zollkammer eingerichtet, um Zölle auf polnische Waren einzuziehen, die über die Weichsel nach Danzig verschifft wurden. Ab 1772 war Marienwerder Verwaltungssitz der im Zuge der Teilungen Polens entstandenen preußischen Provinz Westpreußen, das Schloss wurde zum Sitz der „Kriegs- und Domänenkammer“ (1808 in „Westpreußische Regierung“ umbenannt).
19. und 20. Jahrhundert
Im Zuge der Verwaltungsreformen von 1815 wurde der Hauptsitz der Provinz nach Danzig/Gdańsk verlegt, Marienwerder blieb Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks und Sitz des Oberlandesgerichts. 1860 wurden in der Stadt Wasserleitungen und Kanalisation errichtet, 1890 baute man Gaswerke, 1883 erfolgte der Anschluss an die Eisenbahnlinie. Ab 1920 wurde sie im Zuge der Verwaltungsreform zur Hauptstadt des Regierungsbezirks Westpreußen in der Provinz Ostpreußen. Nach dem Versailler Vertrag von 1919 fielen ca. 40 Prozent des Landkreises Marienwerder an den wiedergegründeten polnischen Staat, in der Stadt selbst wurde 1920 eine Volksabstimmung durchgeführt, die mit 92,5 Prozent zugunsten Deutschlands entschieden wurde.
Am 30. Januar 1945 wurde die Stadt von der Roten Armee eingenommen und diente danach bis Ende des Jahres als Lazarettstandort für ca. 20.000 Verwundete. Beim Truppenabzug wurde die Altstadt in Brand gesetzt. Die deutsche Bevölkerung war zu großen Teilen geflohen. Die Verbliebenen wurden vertrieben. Die Stadt kam unter polnische Verwaltung und wurde neubesiedelt, hauptsächlich mit vertriebenen Polen aus Grodno (heute Weißrussland/Belarus); sie wurde offiziell in Kwidzyn umbenannt. Die beim Brand beschädigten Häuser wurden abgerissen, das Baumaterial für den Wiederaufbau von Warschau eingesetzt. In der Nachkriegszeit entwickelte sich die Stadt zum Sitz von Lebensmittel-, Keramik- und Bauindustrie, 1973 wurden Zellulose- und Papierwerke eröffnet. Nach der politischen Wende von 1989 wurden im Bereich der Sonderwirtschaftszone Kwidzyn mehrere Unternehmen der Papier-, Verpackungs- und Elektrobranche angesiedelt.
Bevölkerung
Um 1400 lag die Einwohnerzahl bei ca. 700 Personen, sie stieg bis zum frühen 19. Jahrhundert (1825) auf rund 5.000, 1905 betrug sie 11.819, 1936 dann ca. 20 000.[2] 1910 gaben rund zehn Prozent der Bewohner des Landkreises Marienwerder Polnisch und knapp 90 Prozent Deutsch als ihre Muttersprache an, bei der Volksabstimmung von 1920 stimmten 6,5 Prozent der Stimmberechtigten für den Anschluss des Landkreises und 93,5 Prozent für Deutschland an Polen.[3]
Durch die Neubesiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg erreichte die Einwohnerzahl 1965 einen Stand von ca. 13.000 Einwohnern, heute leben in der Stadt gut 38.000 Menschen.[4]
Kunstgeschichte und Architektur
Die erste Burg, Insula Sanctae Mariae genannt, wurde von den Ordensrittern 1233 errichtet, jedoch bereits ein Jahr später etwas weiter nach Süden an die Stelle einer ehemaligen prußischen Feste verlegt und dort als eine gemauerte Anlage errichtet. Sie war damit eine der ältesten Burgen, die in Preußen aus festem Material errichtet wurden. Grabungsergebnissen aus den Jahren 1930–1933 zufolge handelte es sich bei der ersten Burg (dem sogenannten Altschlösschen) um eine Zweiflügelanlage mit Wehrtürmen und vermutlich einem Bergfried, rechtwinklig um einen Innenhof angelegt. 1254 ging die Burg in den Besitz der Bischöfe von Pomesanien über und diente als deren Residenz (bis zur Verlegung nach Riesenburg Ende des 13. Jahrhunderts). Während des Pfaffen- und des Reiterkriegs in den Jahren 1457 und 1519 stark beschädigt, wurde sie schließlich 1520 abgerissen, ihr Baumaterial wurde nachträglich für den Bau der Kapitelburg, der Kathedrale bzw. für weitere städtische Bauprojekte verwendet.
Nach der Verlegung der bischöflichen Residenz entstand in Marienwerder der Neubau einer mit der Kathedrale verbundenen repräsentativen Residenz für das Domkapitel von Pomesanien, eine reguläre Vierflügelanlage aus Backstein mit einem zweigeschossigen Kreuzgang um den Innenhof und vier Ecktürmen (der südöstliche diente gleichzeitig als Glockenturm des angrenzenden Doms). Im Westen wurde die Burg über einen 55 Meter langen, auf fünf Bögen gestützten Verbindungsgang mit einem monumentalen Danskerturm (einer Abortanlage) verbunden, ein weiterer, 25 Meter langer Gang im Norden führte zu einem Brunnenturm. Nach Einführung der Reformation diente die Burg zunächst als Sitz eines evangelischen Bischofs (bis 1529), dann als Residenz der herzoglichen Hauptleute. Nach 1772 wurden in der ehemaligen Burg verschiedene Ämter untergebracht, u. a. Gericht und Gefängnis, sowie diverse Lagerräume, 1792 wurden der östliche und der südliche Burgflügel abgerissen. Erst 1854 begann man mit Restaurierungsmaßnahmen, bei denen ein Teil der Anlage rekonstruiert wurde. Bis 1935 diente sie als Gefängnis, 1936–1945 als Sitz einer Reichsführerschule der Hitlerjugend. Nach der Einnahme durch die Rote Armee wurden die Innenräume geplündert. Seit 1949 ist die Burg ein Museum.
Domkirche St. Maria und St. Johannes
Die erste Kirche an der Stelle der heutigen Kathedrale wurde 1264–1284 errichtet, damals noch als Pfarrkirche. Aus diesem Bau stammt möglicherweise die ebenfalls auf die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts datierte Bauplastik der südlichen Vorhalle der heutigen Domkirche. Nach den neuesten Forschungen wurden die Skulpturen von gotländischen Steinmetzen hergestellt. Im 16. Jahrhundert wurde die Bauplastik des inneren und des Außenportals in den neuerrichteten kubischen Anbau der Vorhalle integriert und im 19. Jahrhundert mit dekorativem Dreipassabschluss gekrönt. 1284 wurde die Kirche in den Rang der Kathedrale der Diözese Pomesanien erhoben und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts durch einen gotischen Neubau aus Backstein ersetzt, dessen Westseite an den (heute nicht mehr vorhandenen) Ostflügel der Burg grenzte. Das Bauwerk präsentiert sich heute als Pseudobasilika mit dreischiffigem Langhaus und einschiffigem, polygonal abgeschlossenem Chor in gleicher Höhe und mit hohem Glockenturm im Südwesten, der zugleich der Eckturm der angrenzenden Burg war; der gesamte Bau wurde von außen mit Wehrgängen versehen. Im Inneren haben sich Reste von Wandmalereien aus der Zeit um 1380 erhalten, die friesartig unter den Fenstern im Langhaus und an den Chorwänden angebracht waren (Szenen aus dem Leben Christi und Mariens, im Chor Darstellungen der pomesanischen Bischöfe und Hochmeister des Deutschen Ordens – drei von ihnen wurden in der Krypta unter dem Chor bestattet). Die Wandmalereien wurden im 19. Jahrhundert ‚kreativ’ saniert. Von venezianischen Handwerkern, die zuvor am Prager Veitsdom tätig gewesen waren und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts die monumentale Marienfigur am Chor der Schlosskirche der Marienburg geschaffen hatten, stammt ein Mosaik über dem Südportal mit der Darstellung des Martyriums des hl. Johannes des Evangelisten.
Mit dem Übergang des Herzogtums Preußen zum Protestantismus verlor die Kirche ihre ursprüngliche Funktion, die Wände wurden übertüncht. 1705 wurde an der Nordseite die Grabkapelle der Familie von Groeben angebaut. 1807, während der napoleonischen Kriege, diente die Kirche vorübergehend als Lager. 1862–1864 wurde der Innenraum restauriert und bekam einige neugotische Ausstattungselemente (u. a. den Hochaltar und die Kanzel). 1945 wurde die Kirche zunächst von den Franziskanern übernommen. Seit 1993 ist sie Konkathedrale der Diözese Elbing. Von 1993 an wurde sie umfassend restauriert.
Religions- und Kirchengeschichte
Nach der Gründung der Stadt durch den Deutschorden war Marienwerder eine Marienkultstätte. Eine wichtige Rolle spielte in der Stadt die Mystikerin Dorothea von Montau, die sich in der Domkirche in einer Zelle einmauern ließ und dort 1394 verstarb; 1976 wurde sie heiliggesprochen. Nach der Säkularisation des Ordensstaates 1525 wurde die Stadt lutherisch, auch der amtierende pomesanische Bischof Eberhard von Queiss (um 1490–1529) konvertierte zum evangelischen Glauben. Sein Nachfolger Paul Speratus (1484–1551) wurde zum letzten evangelischen Bischof der Stadt. Kurzzeitig, von 1549 bis 1574, gab es eine Gemeinde der Böhmischen Brüder. Erst mit der Industrialisierung erfolgte ein Zuzug von Vertretern anderer Glaubensrichtungen, u. a. Katholiken, die 1858 ihre Kirche erbauten. Ab 1798 waren auch Juden ansässig, 1832 wurde in der Stadt die erste Synagoge errichtet, 1930 eine weitere. Die Anzahl der Juden lag 1858 bei rund fünf Prozent aller Einwohner und nahm bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert kontinuierlich ab. Während der Reichspogromnacht 1938 wurde die Synagoge niedergebrannt, der jüdische Friedhof war bereits 1935 zerstört worden. Die letzte jüdische Familie verließ die Stadt Anfang 1939. Nach 1945 wurde die Domkirche entsprechend der konfessionellen Zugehörigkeit der zugezogenen polnischen Bevölkerung wieder katholisch.
4. Bibliographische Hinweise
Literatur
- Mieczysław Haftka: Zamek w Kwidzynie [Das Schloss in Kwidzyn]. Malbork 1983.
- Christofer Herrmann: Die pomesanische Kapitelsburg und der Dom in Marienwerder. In: Joachim Zeune, Hartmut Hofrichter (Hg.): Burg und Kirche: Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion; Kolloquium des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Burgenvereinigung Würzburg 2011. Braubach 2013, S. 231–242.
- Waldemar Heym: Das ‚Altschlösschen’ in Marienwerder. Eine Burg der Alt-Preussen, eine Burg des Deutschen Ritter-Ordens, eine Burg des Bischofs von Pomesanien. Marienwerder 1933.
- Liliana Krantz, Jerzy Domasłowski: Katedra i zamek w Kwidzynie [Kathedrale und Schloss in Kwidzyn]. Warszawa u. a. 1982.
- Teresa Mroczko, Adrian Arszyński (Hg.): Architektura gotycka w Polsce [Gotische Architektur in Polen]. Warszawa, Instytut Sztuki PAN, 1995.
- Bernhard Schmid: Die Domburg Marienwerder. Elbing 1938.
- Max Töppen: Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstbauten. Marienwerder 1875.
- Tomasz Torbus: Kruchta południowa katedry w Kwidzynie – najstarszy przykład rzeźby architektonicznej w pruskim państwie Zakonu Krzyżackiego [Die südliche Vorhalle der Domkirche in Kwidzyn, das älteste Beispiel der Bauskulptur im Ordensland Preußen]. In: Justyna Liguz (Hg.): Studia z dziejów diecezji pomezańskiej w 775 rocznicę jej utworzenia. Materiały z V. Sympozjum Dorotańskiego w Kwidzynie (23 VI 2018) [Studien zur Geschichte der Diözese Pomesanien anlässlich ihres 775. Jubiläums. Materialien des 5. Dorotański-Symposiums in Kwidzyn, 23. Juni 2018]. Pelplin 2020, S. 39–56, 164–177.
- Tomasz Torbus: Die südliche Vorhalle der Domkirche in Marienwerder – das älteste Beispiel der Bauskulptur im Ordensland Preußen, 2021 [in Vorbereitung].
- Erich Weise (Hg.): Handbuch der historischen Stätten. Band: Ost- und Westpreußen (= Kröners Taschenausgabe. Band 317). Unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1966 Stuttgart 1981, S. 133–136.
- Erich Wernicke: Marienwerder, Geschichte der ältesten Stadt der Reichsdeutschen Ostmark. Marienwerder 1933.
- Tadeusz Wiśniewski: Katedra i zamek kapituły biskupstwa pomezańskiego w Kwidzynie. Przewodnik [Domkirche und Schloss des bischöflichen Domkapitels in Kwidzyn. Reiseführer]. Kwidzyn 1994.
Weblinks
- www.celle.de/Celle-entdecken/Partnerst%C3%A4dte/Kwidzyn-Polen-.php?object=tx,2727.5&ModID=7&FID=2092.178.1&NavID=2727.396&La=1 (Informationen der Stadt Celle über ihre polnische Partnerstadt Marienwerder/Kwidzyn)
- pomorskie.travel/de/-/katedra-pw-sw-jana-ewangelisty-w-kwidzynie (Informationen zur Domkirche St. Maria und St. Johannes im Reiseportal Pomorskie)
- pomorskie.travel/de/-/muzeum-zamkowe-w-kwidzynie (Informationen über das Burgmuseum im Reiseportal Pomorskie)
- www.herder-institut.de/bildkatalog/wikidata/Q326582 (Abbildungen zu Marienwerder/Kwidzyn im Bildarchiv des Herder-Instituts, Marburg)
Anmerkungen
[1] Vgl. Weise 1981, S. 133.
[2] Vgl. Weise 1981, S. 133f.
[3] Vgl. Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej/Annuaire statistique de la République Polonaise 1 (1920/22), Teil 2. Warschau 1923, S. 358 (online: www.herder-institut.de/digitale-angebote/dokumente-und-materialien/themenmodule/quelle/40/details.html).
[4] Stand 2019. Angaben nach GUS www.polskawliczbach.pl/Kwidzyn (letzter Zugriff 18.10.2020).
Zitation
Beata Lejman, Tomasz Torbus: Marienwerder/Kwidzyn. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2021. URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32262 (Stand 30.07.2021).
Nutzungsbedingungen für diesen Artikel
Copyright © Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk entstand im Rahmen des Projekts „Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ und darf vervielfältigt und veröffentlicht werden, sofern die Einwilligung der Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: ome-lexikon@uol.de
Wenn Sie fachliche Hinweise oder Ergänzungen zum Text haben, wenden Sie sich bitte unter Angabe von Literatur- und Quellenbelegen an die Redaktion.